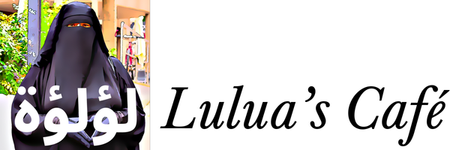Unterschieden werden muss zwischen einem „Feminismus muslimischer Frauen“ und einem „islamischen Feminismus“. Ersterer ist nicht religiös begründet, zweiterer hat seine Wurzeln im Quran und in der Sunna.
Muslimischer Feminismus betont, dass sich muslimische Frauen in ihrer historischen und sozialen Situation von „westlichen“ Frauen unterscheiden und darum andere Schwerpunkte setzen, die sich aus diesen Unterschieden ergeben. So sind muslimische Frauen oft mehrfach diskriminiert, als Frauen, als Musliminnen und oft auch aufgrund ihrer Abstammung und Hautfarbe.
Islamischer Feminismus betont, dass sich Frauen, die sich auf Quran und Sunna beziehen, von „westlichen“, oft atheistischen oder christlichen Frauen unterscheiden und darum andere Schwerpunkte setzen. Sie betonen die spirituelle und praktische Rolle des Islams in ihrem Leben.
Im Folgenden soll es um den islamischen Feminismus religiös-konservativer Frauen gehen; ich lasse den Feminismus religiös-liberaler Frauen außer Acht, da sie in der Regel nicht nur keinen Hidschab tragen, sondern diesen auch häufig ablehnen. Hier soll es um religiös-konservative Frauen gehen, die meist den Hidschab tragen. Für viele Menschen im Westen ist dies ein vermeintlicher Widerspruch.
„Feminismus“ ist für viele muslimische Frauen ein ungeliebter Begriff – er steht vielfach für einen als übergriffig empfundenen westlichen „weißen“ Feminismus, der muslimische Frauen von angeblichen Zwängen ihrer Religion befreien will, für Paternalismus, Bevormundung, Unfreiheit. Für viele ist „Feminismus“ gleichbedeutend mit Islamfeindlichkeit. Daran trägt natürlich auch der Femonationalismus einen gewichtigen Anteil, der Feminismus für die politische Agenda rechter islamfeindlicher Kreise instrumentalisiert.
Muslimische Frauen sprechen oft eher von Empowering, von Selbstermächtigung, Emanzipation. Und für sie ist Emanzipation kein Widerspruch zum Islam, sondern im Islam angelegt.
Der islamische Feminismus nahm seinen Anfang zu Beginn des 20. Jahrhunderts, vor allem in Ägypten. Das erste große Anliegen war die Integration der Mädchen und Frauen in die Gesellschaft in die Gesellschaft und ihre Bildung. Nur gebildete Frauen könnten Vorbilder und Lehrerinnen ihrer Kinder sein.
Westliche Einflüsse
In den 1950er und 1960er Jahren wurde oft ein westlicher Feminismus importiert, der eher antireligiös war – und besonders den Verzicht auf das Kopftuch bzw. den Schleier propagierte, teilweise auch erzwang, etwa im Iran und in Afghanistan. Der Weg in die Moderne sollte möglichst laizistisch erfolgen, die Religion zurückgedrängt werden. Man wollte sich der „modernen Welt“ anpassen. Wichtig erschien es der Politik, die Frauen zu „befreien“, auch gegen ihren Willen.
Mit dem Kampf gegen den Hidschab folgte man der Tradition der Kolonialmächte (insbesondere Frankreichs), muslimische Frauen gewaltsam zu entschleiern und damit – wie viele von ihnen es empfanden – zur Schau zu stellen. Das traf natürlich auf die Gegnerschaft religiöser Muslime – Männer und auch Frauen. Sie empfanden diesen Feminismus als einen Angriff auf ihre Religion und ihre Kultur.
Westlichen Feministen wurde und wird, meist zu Recht, vorgeworfen, dass sie nie das Mandat muslimischer Frauen erhalten hätten, sich für ihre „Befreiung“ einzusetzen. Sie wurden und werden als kolonialistisch und paternalistisch betrachtet.
Liberale Einflüsse
Liberale muslimische Frauen glauben zwar, dass der Quran Gottes Wort ist – aber streng genommen Gottes Menschenwort. Sie pflegen eine historisch-kritische Theologie, betrachten also den historischen Kontext des Qurans. Für sie gibt es Aussagen im Quran, die heute keine Gültigkeit mehr besäßen – darunter auch viele der Aussagen, bei denen es um die Frauen und ihre Rolle und ihr Verhalten im Alltag geht, auch zum Hidschab. Sie wollen dabei meist nicht nur entsprechende Aussagen neu deuten, sondern für ungültig erklären. Für sie gelten meist nur die von ihnen so betrachteten „spirituellen Aussagen“ und die ethischen Werte des Qurans, nicht aber die Handlungsanweisungen für den Alltag und die Gesetze, die Scharia.
Für sie sind Frauen und Männer gleichwertig, gleichartig und gleichberechtigt. Es gibt für sie keine Gründe, dass Frauen anders behandelt werden als Männer oder sich anders verhalten müssten.
Viele dieser Frauen tragen keinen Hidschab und lehnen oft auch bestimmte Formen des Hidschab ab, etwa Abaya, Dschilbab oder Nikab. Muslimische Frauen werden oft ermutigt, den Hidschab abzulegen. Forderungen, Dschilbab oder Nikab zu verbieten, werden oft unterstützt.
Bei konservativen muslimischen Frauen trifft diese Einstellung vornehmlich auf wenig Sympathie. Für sie gibt es keine ungültigen Aussagen im Quran, und die Gesetze und Handlungsanweisungen gelten weiterhin. Sie wollen der Scharia folgen.
Religiös-konservativer Feminismus
Religiös-konservative Musliminnen streben eine geschlechtergerechte Gesellschaft an. Familie, Moral und Bildung haben für sie einen hohen Stellenwert, besonders aber die Religion. Sie glauben, dass der Quran Gottes Wort ist. Neben dem Quran orientieren sie sich auch an der Sunna, dem Beispiel des Propheten Muhammad, Friede sei auf ihm, und seiner Gefährten.
Für sie sind alle nötigen Frauenrechte bereits im Islam verankert, im Quran, in der Sunna, in der Scharia. Diese seien später aber von Männern, die über Frauen bestimmen und sie unterdrücken wollten, frauenfeindlich umgedeutet und von patriarchalen Traditionen überlagert worden und müssten wiedererlangt werden.
Diese Frauen gehen in der Regel davon aus, dass Frauen und Männer gleichwertig, jedoch nicht gleichartig seien. Auch wenn die religiös begründeten Unterschiede teilweise eine unterschiedliche Behandlung erforderten (etwa bei den Hidschab-Regeln), seien Frauen und Männer dennoch im Wesentlichen gleichberechtigt. Die Gleichwertigkeit steht über der Verschiedenartigkeit und muss jederzeit gewährleistet sein. Unterschiede, die lediglich auf patriarchalen Traditionen und nicht der Religion beruhen, müssen abgeschafft werden. Sie wollen ihre von Quran und Sunna zugesicherten Rechte ungehindert ausüben können. Besonders wichtig ist ihnen, dass Frauen aktiv an der Gemeinschaft teilhaben können - und dass Mädchen und Frauen freien Zugang zur Bildung haben.
Die meisten religiös-konservativen Feministinnen tragen Hidschab, da dies für sie eine von Gott gewollte Regel ist. Manche tragen auch Abaya oder Dschilbab, einige auch einen Nikab. Sie lehnen aber jeden Zwang ab. Mädchen und junge Frauen sollen durch Bildung und Vorbilder ein „Ja“ zum Hidschab finden, nicht durch Gängelei oder Zwang.
Diese Frauen fordern die Deutungshoheit darüber ein, wie sie ihren Glauben praktizieren und ihr Leben führen. Sie lesen den Quran und lassen sich nicht vorschreiben, wie sie ihn zu verstehen haben. Sie glauben, dass der Quran zu lange nur von Männern ausgelegt wurde und Frauen davon abgehalten wurden, was ihrer Überzeugung nach nicht im Sinne Gottes und des Propheten, Friede sei auf ihm, sei. Frauen seien ebenso wie Männer fähig, den Quran zu lesen, zu verstehen und auszulegen. Ihre Erkenntnisse dürften nicht unterdrückt werden.
Die westliche Einstellung „Das Kopftuch ist das Symbol der Unterdrückung der Frauen“ ist für sie ein unzulässiger Eingriff in ihre Deutungshoheit und damit in ihre Freiheit. Der Westen habe nicht das Recht, ein solches Urteil zu fällen oder gar Verbote zu fordern, so wenig, wie irgendwelche Männer das Recht haben, sie zum Tragen des Hidschabs zu zwingen. Diese muslimischen Frauen entscheiden selbst, ob sie den Hidschab tragen – und wenn sie ihn tragen, dann als Ausdruck, als Bekenntnis ihrer Liebe zu Gott; und niemand außer ihnen hat da die Deutungshoheit. Kein Mann und kein westlicher Feminismus.
Der Satz „Der Hidschab bedeutet für mich Freiheit!“ ist einerseits ein Bekenntnis zum islamischen Glauben, aber andererseits auch eine Reaktion auf Versuche der Männer oder des Westens, sie zu bevormunden. Sie entscheiden selbst, und sie entscheiden sich für die Religion und die Gebote Gottes. Der Hidschab ist für sie ein Akt des Empowerings, der Selbstermächtigung, ein Symbol der Freiheit, selbst zu entscheiden, wie sie ihren Glauben praktizieren und ihr Leben führen.
Der Westen muss lernen, die Selbstermächtigung muslimischer Frauen zu akzeptieren, statt sie zu bevormunden und sie „befreien“ zu wollen. Der säkulare Feminismus, gerade der Feminismus der zweiten Welle, ist für viele religiöse Musliminnen inakzeptabel, weil er sie entmündigt. Sie wollen einen Austausch auf Augenhöhe. Wenn sie nur als „Opfer“ der Religion oder patriarchaler Strukturen gesehen werden, ist das nicht möglich.