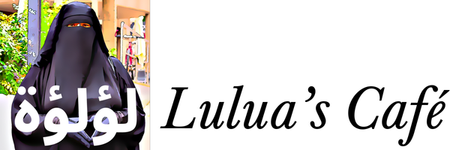Ein Ritual ist inzwischen bei Diskussionen über Hidschab und Nikab der Verweis auf die Situation der Frauen im Iran und in Afghanistan und den dortigen Zwang zur Verschleierung. Daraus schließen viele, dass Verschleierung immer etwas mit Zwang und Unterdrückung zu tun habe. Um die anderen Schwierigkeiten der Frauen dort geht es eigentlich nie, das scheint gar nicht zu interessieren.
Es ist eine Tatsache, dass die Situation für Frauen und Mädchen in diesen Ländern in höchstem Maße problematisch ist. Und das längst nicht nur im Hinblick auf den Hidschab oder den Nikab.
Fragt man allerdings Frauen in Afghanistan nach ihren Problemen, wird der Schleier selten genannt. Es sind all die anderen Dinge, mit denen die Frauen dort unterdrückt werden. Und während der Schleier im Iran ein starkes Symbol für die Unterdrückung der Frauen ist, werden auch hier meist andere Probleme genannt, mit denen die Frauen zu kämpfen haben. Im Westen sind die aber oft weit weniger interessant als der Schleierzwang. Und sie können nun mal nicht so gut für die oft islamfeindliche Agenda gegen den Schleier und für Forderungen entsprechender Verbote instrumentalisiert werden.
Ist die Situation der Frauen in Afghanistan und im Iran typisch für muslimische Frauen? Ist sie mit der Situation muslimischer Mädchen und Frauen in Deutschland vergleichbar? Nein, ist sie nicht. Nicht im Blick auf den Schleier und auch nicht im Blick auf die übrigen Lebensumstände der Frauen dort.
Afghanistan ist (wie auch Teile von Pakistan und Bangladesch) stark vom Deobandi-Islam und vom Paschtunwali, dem vorislamischen Sitten- und Rechtskodex der Paschtunen, bestimmt. Das war auch bereits vor der Machtergreifung der Taliban so. Der paschtunische Islam nimmt eine Sonderrolle ein, auch, weil er recht viele vorislamische Elemente wie eben den Paschtunwali und auch den Tschaderi (die „Burka“) beibehalten hat. Natürlich leben auch in Deutschland paschtunische Muslime, aber unter den hiesigen Muslimen stellen sie eine Minderheit dar. Die meisten Muslime praktizieren einen Islam, der sich deutlich davon unterscheidet (auch viele paschtunische Muslime, die in der Diaspora leben, haben sich von den strengen Sitten gelöst).
Der Iran ist stark vom schiitischen Islam geprägt. Der Gesichtsschleier ist im schiitischen Islam praktisch unbekannt und spielt dementsprechend im Leben iranischer Frauen keine Rolle. Nur bei der sunnitischen Minderheit des Landes, die etwa am Arabischen Golf lebt, kommt der Gesichtsschleier in einer meist sehr traditionellen Form vor. Das Regime in Teheran ist für die meisten der dort lebenden Muslime viel zu streng in der Auslegung des Islam, viel zu strikt bei den religiösen Forderungen an das Leben im Alltag. Viele Frauen im Iran kämpfen gegen den obligatorischen Hidschab – darunter auch viele Frauen, die sich verschleiern, aber den Zwang ablehnen. Manche von ihnen legen deswegen ihren Schleier aus Protest ab. Beim Kampf gegen den obligatorischen Hidschab geht es nicht eigentlich um den Schleier. Er ist Symbol für die vielfältigen Zwänge, die das Regime den Menschen auferlegt. Das Ablegen des Schleiers beispielsweise ist eine Reaktion darauf, dass das Regime besonders auf die Einhaltung der Hidschab-Regeln (auch für die Männer, was im Westen häufig übersehen wird) achtet und Frauen und Männer, die dagegen verstoßen, besonders streng bestraft. Es bedeutet aber nicht, dass der Schleier das größte Problem der Frauen dort ist, er ist ein Problem unter vielen, das halt als Symbol herausgegriffen wird, so wie das Regime ihn als Symbol nutzt.
Beide Länder sind jedenfalls nicht typisch für den Islam – und damit auch nicht dafür, wie muslimische Frauen leben und wie sie sich verschleiern.
Kritik am Schleier aufgrund der Verhältnisse in Afghanistan und im Iran reduziert die Probleme der Frauen dort oft auf den Schleier und blendet all die anderen Probleme aus, mit denen sie (und oft auch die Männer) zu kämpfen haben. Man ist oft nicht wirklich daran interessiert, sich mit diesen anderen Problemen zu befassen. Es geht nur darum, das Tragen des Schleiers hierzulande mit dem Verweis auf den Schleierzwang in diesen beiden Ländern zu kritisieren. Dahinter steckt meist nicht Sorge um die dort lebenden Frauen, sondern deren Situation wird für eine islamfeindliche Agenda instrumentalisiert.
Die Frauen im Iran kämpfen wie zuvor besprochen gegen den obligatorischen Hidschab – nicht gegen den Schleier selbst. Sie wollen nicht, dass niemand mehr Schleier trägt, sondern dass niemand mehr dazu gezwungen wird, den Schleier zu tragen und die anderen Regeln, die den Menschen vom Regime aufgezwungen werden, zu befolgen. Sie kämpfen für die Freiheit, dass jede Frau selbst entscheiden kann, ob sie sich verschleiert oder nicht.Viele der gläubigen Frauen, die gegen den obligatorischen Hidschab protestieren, sind überzeugt, dass es keinen Zwang in der Religion geben darf.
Diese Frauen wollen für ihren Kampf unsere Solidarität – aber nicht in der Form, dass nun Frauen im Westen auf den Schleier verzichten. Solidarität kann etwa bedeuten, dass Frauen, die Hidschab tragen, vom Regime fordern, dass der Zwang zum Schleier aufgehoben wird. Dass das Regime den Menschen mehr Freiheiten ermöglicht. Das Regime kann dann nicht sagen, dass diese Frauen gegen den Schleier und gegen den Islam seien. So sind gerade gläunige muslimische Frauen mit Schleier wichtige Verbündete der Frauen im Iran, wenn sie sich gegen den Zwang aussprechen.
Abschließend kann festgehalten werden, dass es keinen direkten Zusammenhang zwischen dem Schleierzwang im Iran und in Afghanistan einerseits und dem Tragen des Schleiers durch muslimische Frauen im Westen andererseits gibt. Die Situation im Iran und in Afghanistan eignet sich nicht, um mit dem Verweis darauf über die Verschleierung im Westen zu sprechen oder diese womöglich verbieten zu wollen.
Gerade Femonationalisten verweisen für ihren Kampf gegen den Islam und den Schleier gerne auf die Situation im Iran und in Afghanistan. Es geht ihnen dabei aber nicht um die Frauen dort; sie instrumentalisieren sie für ihre politische Agenda.